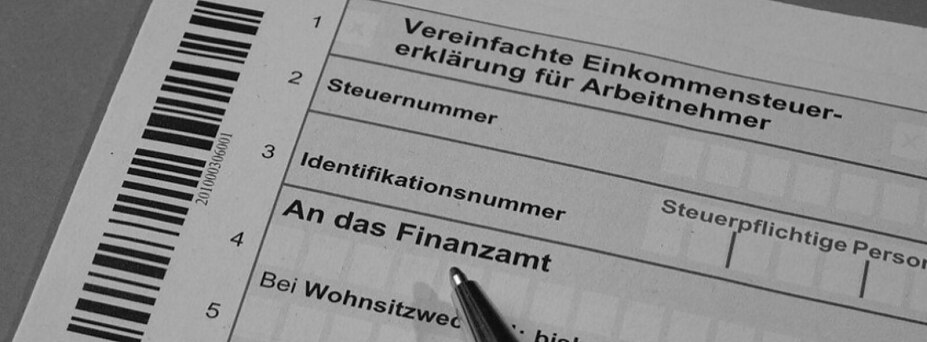Sicher durch das Steuerstrafrecht – mit JusLegal in Hamburg
Für viele Unternehmerinnen, Unternehmer und Privatpersonen stellt das Zusammenspiel von Steuerrecht und Strafrecht eine große Herausforderung dar. Die rechtlichen Folgen bei einem Verdacht auf Steuerhinterziehung sind weitreichend und betreffen sowohl finanzielle als auch strafrechtliche Bereiche. Die Kanzlei JUSLEGAL gehört mit über 20 Jahren Erfahrung zu den führenden Kanzleien im Bereich Strafrecht in Hamburg und wurde im Jahr 2020 als “Criminal Law Firm of The Year” ausgezeichnet. Rechtsanwalt Jürgen F. Berners, Fachanwalt für Steuerrecht, erklärt in diesem Artikel, wie Sie sich im Steuerstrafrecht richtig positionieren, welche Schritte zur Risikominimierung sinnvoll sind und warum frühzeitige anwaltliche Unterstützung oft entscheidend sein kann.
„Die Zuständigkeiten der beteiligten Behörden – etwa des Finanzamts, der Steuerfahndung sowie der Bußgeld- und Strafsachenstellen – sind schwer durchschaubar und unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland“, erklärt der Experte. „Sobald ein Ermittlungsverfahren eröffnet wird, verfügen die Behörden jedoch über weitreichende Befugnisse, darunter Durchsuchungen, Vermögenssicherungen oder sogar Untersuchungshaft.“
Die rechtlichen Grundlagen für alle steuerrechtlichen Straftaten und ihre Konsequenzen schaffen die §§ 369 ff. der Abgabenordnung (AO). Diese Paragraphen regeln das gesamte Verfahren zur
Festsetzung und Erhebung von Steuern sowie die Aufgaben der Finanzbehörden und die Grundsätze des Steuerverfahrens. Dabei wird zwischen verschiedenen Steuerstraftaten unterschieden. Am häufigsten ist jedoch der Tatbestand der Steuerhinterziehung.

Steuerhinterziehung (§ 370 AO)
Bei der Steuerhinterziehung handelt es sich um eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Handlung, durch die in erheblichem Maß Steuern verkürzt oder nicht gezahlt werden. Nach § 370 AO macht sich strafbar, wer steuerlich relevante Angaben (z. B. zu Einkommen, Umsatz oder Gewinn) absichtlich falsch macht oder verschweigt, um Steuern zu hinterziehen.
Die Steuerhinterziehung kann in verschiedenen Formen auftreten, etwa durch:
- Falsche oder unvollständige Angaben in Steuererklärungen: Zum Beispiel durch das bewusste Verschweigen von Einnahmen oder die Angabe unzutreffender Ausgaben.
- Vortäuschung von Steuerbegünstigungen: Etwa wenn Werbungskosten geltend gemacht werden, die gar nicht entstanden sind.
- Nichtabgabe von Steuererklärungen: Wer trotz gesetzlicher Pflicht keine Steuererklärung einreicht, handelt ebenfalls strafbar.
Dabei ist zu unterscheiden: Das Verschweigen von Tatsachen gilt als Unterlassungsdelikt, wohingegen das bewusste Falschangabenmachen als aktives Tun ein Begehungsdelikt darstellt. Eine Steuerhinterziehung liegt erst dann vor, wenn das Ziel – die zu niedrige oder unterlassene Steuerfestsetzung – erreicht wurde. Wird dieses Ziel verfehlt, ist der Tatbestand nicht erfüllt.
Jedoch ist laut § 370 Abs. 2 AO auch bereits der Versuch strafbar. Wird etwa eine unrichtige Steuererklärung eingereicht und fällt dies bei der Veranlagung oder Betriebsprüfung auf, wird der Fall an die zuständigen Stellen – etwa Steuerfahndung oder Bußgeld- und Strafsachenstelle – übergeben. Sollte sich im Verlauf der Ermittlungen herausstellen, dass Angaben vorsätzlich falsch gemacht oder wesentliche Informationen absichtlich verschwiegen wurden, liegt möglicherweise eine versuchte Steuerhinterziehung vor.
Wie entdeckt das Finanzamt Steuerhinterziehung?
Steuerstraftaten wie Steuerhinterziehung oder das Fälschen von Steuerzeichen können dem Finanzamt auf mehreren Wegen bekannt werden – sowohl durch Unachtsamkeiten als auch durch gezielte Prüfungen.
Zu den gängigen Entdeckungsmethoden gehören:
- Gezielte Ermittlungen: Auffälligkeiten in Steuererklärungen oder bei Betriebsprüfungen führen häufig zu weiteren Nachforschungen durch das Finanzamt oder die Steuerfahndung.
- Datenkäufe (z. B. Steuer-CDs): Etwa durch Informationen aus dem Ausland, wie Liechtenstein oder der Schweiz.
- Zufallsfunde: Steuervergehen werden oft im Rahmen anderer Ermittlungen oder Prüfungen entdeckt.
- Unstimmigkeiten bei Belegen: Wenn Rechnungen nicht zusammenpassen, etwa eine abgesetzte Rechnung von einem Unternehmen, das diese gar nicht erstellt hat.
- Hinweise von Dritten: Informationen können auch durch Nachbarn, Konkurrenten oder Bekannte an die Behörden gelangen.
- Selbstanzeigen: Dabei werden häufig auch weitere Beteiligte oder Mitwisser bekannt.
Leichtfertige Steuerverkürzung (§ 378 AO)
Im Unterschied zur Steuerhinterziehung geht es hier nicht um Vorsatz, sondern um grobe Fahrlässigkeit. Auch wenn keine absichtliche Täuschung vorliegt, können strafrechtliche Folgen drohen.
- Fehlerhafte Steuererklärungen aufgrund mangelnder Sorgfalt oder unzureichender Kenntnisse.
- Fehlende Belege oder unvollständige Buchhaltung, die unbeabsichtigt zur Steuerverkürzung führen.
- Verspätete oder unkorrekte Abgabe von Steuererklärungen infolge von Unachtsamkeit oder Unwissenheit.
Die Sanktionen fallen meist geringer aus als bei vorsätzlicher Steuerhinterziehung und reichen von Geldbußen bis hin zu Freiheitsstrafen – letztere jedoch in der Regel auf einem niedrigeren Niveau.
Steuerhehlerei (§ 374 AO)
Steuerhehlerei betrifft den Erwerb, Verkauf oder die Verwertung von Waren, die im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung stehen. Der Tatbestand ist erfüllt, wenn jemand wissentlich solche Waren übernimmt oder verwertet.
Beispiele:
- Verkauf oder Weitergabe von Waren aus Steuerbetrug, etwa nicht versteuerte Zigaretten, Alkohol oder Schmuggelware.
- Erwerb gefälschter Rechnungen oder Unterlagen zur Unterstützung einer Steuerhinterziehung.
- Nutzung oder Weiterverkauf von Vermögenswerten, die aus Steuerdelikten stammen, z. B. Fahrzeuge oder Immobilien, deren Erwerb auf falschen Angaben basiert.

Selbstanzeige – Straffreiheit durch Offenbarung?
Eine Selbstanzeige kann unter bestimmten Voraussetzungen zur Straffreiheit führen. Seit dem 1. Januar 2015 gilt jedoch: Der hinterzogene Betrag darf 25.000 Euro nicht übersteigen, um vollständige Straffreiheit zu erlangen.
Die Selbstanzeige muss beim zuständigen Finanzamt eingereicht werden – maßgeblich ist der Wohnsitz der betroffenen Person, nicht der Ort des Steuervergehens. Die Abgabe bei Polizei oder Staatsanwaltschaft ist unzulässig und führt zum Verlust der strafbefreienden Wirkung.
Waren mehrere Personen beteiligt, muss jede einzelne ihre Selbstanzeige beim jeweils zuständigen Finanzamt einreichen – und das gleichzeitig, um gegenseitige Belastungen zu vermeiden, wie Jürgen Berners betont.
Voraussetzungen für eine wirksame Selbstanzeige
Eine Selbstanzeige kann unter bestimmten Voraussetzungen zur Straffreiheit führen. Seit dem 1. Januar 2015 gilt jedoch: Der hinterzogene Betrag darf 25.000 Euro nicht übersteigen, um vollständige Straffreiheit zu erlangen.
Die Selbstanzeige muss beim zuständigen Finanzamt eingereicht werden – maßgeblich ist der Wohnsitz der betroffenen Person, nicht der Ort des Steuervergehens. Die Abgabe bei Polizei oder Staatsanwaltschaft ist unzulässig und führt zum Verlust der strafbefreienden Wirkung.
Waren mehrere Personen beteiligt, muss jede einzelne ihre Selbstanzeige beim jeweils zuständigen Finanzamt einreichen – und das gleichzeitig, um gegenseitige Belastungen zu vermeiden, wie Jürgen Berners betont.
Voraussetzungen für eine wirksame Selbstanzeige
Die Selbstanzeige muss vollständig sein. Alle hinterzogenen Steuerbeträge sowie fehlerhaften Angaben müssen für sämtliche betroffenen Steuerarten nachträglich offengelegt werden.
Sie muss vor der Entdeckung durch die Behörden eingereicht werden. Sobald Prüfungen angekündigt oder Ermittlungen begonnen wurden, ist eine Selbstanzeige ausgeschlossen.
Zahlung der Steuern und Zinsen: Die hinterzogenen Beträge samt Zinsen müssen umgehend beglichen werden. Dazu zählen auch mögliche Säumniszuschläge.
Jürgen Berners: „Oft erfahren die Behörden erst durch die Selbstanzeige selbst von der Steuerhinterziehung. Problematisch wird es dann, wenn daraus eine Strafverfolgung oder gar Anklage resultiert.“
Was tun, wenn die Selbstanzeige unvollständig war?
Auch wenn eine vollständige Straffreiheit nicht mehr möglich ist, kann die Selbstanzeige strafmildernd wirken. Die Gerichte berücksichtigen in solchen Fällen die Eigeninitiative des Betroffenen. Nach Überprüfung folgt ein neuer Steuerbescheid – dessen fristgerechte Begleichung ist zwingend, sonst entfällt auch hier die strafmildernde Wirkung.
JusLegal – Ihr Partner im Steuerstrafrecht
Mit Standorten in Hamburg, Kiel, München und Ebersberg ist JusLegal Ihr verlässlicher Ansprechpartner. Unsere erfahrenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte stehen Ihnen mit Klarheit und Fachkompetenz zur Seite und begleiten Sie sicher durch die komplexen Herausforderungen des Steuerstrafrechts.
Vertrauen Sie auf JusLegal – wir stehen an Ihrer Seite!